Enshittification – Warum digitale Dienste immer schlechter werden und was wir dagegen tun können
Wer kennt es nicht: Anfangs ist eine neue Plattform großartig – benutzerfreundlich, günstig oder sogar kostenlos. Dann, nach und nach, kippt das Ganze. Auf einmal gibt es mehr Werbung, weniger Funktionen, steigende Preise oder undurchsichtige Regeln. Dieses Phänomen hat inzwischen einen eigenen Namen: Enshittification.
Was bedeutet Enshittification?
Der Begriff wurde 2023 vom kanadisch-britischen Autor und Aktivisten Cory Doctorow geprägt.1 Er beschreibt damit, wie digitale Plattformen sich systematisch verschlechtern: Erst werden Nutzerinnen* mit attraktiven Angeboten angelockt, dann werden Geschäftspartnerinnen (z. B. Händlerinnen, Werbetreibende) stärker belastet, und schließlich wird das gesamte System so lange ausgepresst, bis es für niemanden mehr gut funktioniert.
Mit anderen Worten: Unternehmen optimieren nicht für ein gutes Nutzerinnenerlebnis, sondern für kurzfristige Profite.
Wo begegnet uns Enshittification?
Die meisten von uns stoßen im Alltag ständig darauf, ohne zu realisieren, dass es sich dabei um Enshittification handelt:
- Soziale Netzwerke: Facebook, Instagram oder TikTok zeigen immer weniger Beiträge von Freundinnen, dafür immer mehr gesponserte Inhalte. Was früher lebendig und persönlich war, gleicht aktuell eher einem endlosen Werbefeed.
- Streamingdienste: Netflix oder Spotify erhöhen regelmäßig die Preise, kürzen Features oder beschränken Accounts. Gleichzeitig veröffentlichen sie Eigenproduktionen, die nicht immer die gewünschte Qualität haben.
- Online-Shopping: Auf Plattformen wie Amazon werden oft eigene Produkte bevorzugt angezeigt, während unabhängige Händler verdrängt werden. Die Übersichtlichkeit leidet, das Vertrauen sinkt.
Kurz gesagt: Ob Kommunikation, Unterhaltung oder Einkaufen – viele digitale Angebote fühlen sich schlechter an als noch zu Beginn der Nutzung.
Enshittification nicht nur online
Auch wenn der Begriff „Enshittification“ sich ursprünglich auf digitale Plattformökonomie bezieht, begegnet uns das Phänomen längst auch in der analogen Welt. Das Grundmuster ist immer ähnlich: Zunächst locken Unternehmen mit attraktiven Leistungen, um Kundinnen zu gewinnen. Später werden Stück für Stück Leistungen wieder einkassiert, Zusatzkosten eingeführt und/oder die Qualität reduziert – bis am Ende kaum noch vom ursprünglichen Vorteil die Rede sein kann. Hier ein paar Beispiele aus der analogen Welt, die ihr vielleicht auch schon beobachten konntet:
- Fluggesellschaften: Früher gab es mehr Beinfreiheit, kostenlose Mahlzeiten und großzügige Gepäckregeln. Heute müssen Passagiere für fast jedes Extra zahlen, von der Sitzplatzwahl bis hin zum Handgepäck.
- Kreuzfahrtanbieter: Anfangs noch als luxuriöses Rundum-sorglos-Erlebnis beworben, sind inzwischen viele Leistungen ausgelagert oder nur noch gegen hohe Aufpreise verfügbar. Getränke, Ausflüge oder selbst bestimmte Serviceleistungen sind selten im Grundpreis enthalten. Viele Kreuzfahrtpreise sind mit Zusätzen wie “Premium-Getränkepaket” oder Spezialausflügen bestückt, die ehemals in der Grundausstattung enthalten waren.
- Autoindustrie: Fahrzeuge, die früher mit solider Grundausstattung kamen, werden heute künstlich beschnitten. Software-Features wie Sitzheizung oder Tempomat lassen sich teilweise nur per Abo freischalten – obwohl die Technik bereits eingebaut ist.2
- Banken & Versicherungen: Konten oder Policen starten oft mit attraktiven Konditionen. Nach einer Weile steigen jedoch die Gebühren, Leistungen werden eingeschränkt oder Beratungsangebote durch digitale Selbstbedienung ersetzt.
Diese analogen Beispiele zeigen: Enshittification ist kein reines „Internetproblem“. Es ist ein Muster, das überall entstehen kann, wo kurzfristige Gewinnmaximierung langfristig über Kundinnenzufriedenheit gestellt wird:
Phase 1 = Kundinnengewinnung mit überdurchschnittlicher Leistung, Phase 2 = langsames Ausdünnen und Monetarisieren, Phase 3 = völlige Dominanz von Profit über Nutzen.
Unsere vier Tipps, um gegenzusteuern
Wir können Enshittification nicht komplett verhindern – aber wir sind ihr auch nicht hilflos ausgeliefert. Hier kommen drei Strategien, die dir dabei helfen können, selbstbestimmter zu handeln:
- Bewusst Alternativen nutzen
Statt automatisch bei den Big Playern wie Amazon oder Netflix zu landen, kann es sich lohnen, kleinere Anbieterinnen auszuprobieren. Regionale Onlineshops, unabhängige Streamingplattformen oder Nischen-Communities bieten oft ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis und respektieren ihre Nutzerinnen mehr. - Eigene Daten schützen
Viele Plattformen verschlechtern sich nicht nur durch Werbung, sondern auch durch aggressive Datensammlung. Mit Tools wie Werbeblockern, datensparsameren Browsern oder alternativen Messengern können wir selbst bestimmen, wie viel wir preisgeben wollen. - Kollektiven Druck ausüben
Unternehmen reagieren, wenn sie merken, dass unzufriedene Nutzerinnen abwandern. Bewertungen, Kündigungen oder auch öffentliche Diskussionen (z. B. in Foren oder Medien) zeigen Wirkung. Je sichtbarer die Kritik, desto größer der Druck auf Anbieterinnen, bessere Entscheidungen zu treffen. Verbraucherzentralen, Online-Bewertungen und direkte Beschwerden wirken – gerade bei renommierten Unternehmen, die ihren Ruf nicht verlieren wollen. Je mehr Menschen unfaire Praktiken öffentlich machen, desto eher geraten Anbieterinnen unter Druck. - Newsletter statt Algorithmus Plattformen können sich verschlechtern, Features einschränken oder Inhalte verzerren. Ein verlässlicher Weg, um langfristig wertvolle Inhalte zu erhalten, sind unabhängige Newsletter. So bist du nicht nur von Algorithmen abhängig, sondern bekommst regelmäßig direkten, unverfälschten Content von den Menschen, die du schätzt. Tipp: Abonniere die Newsletter deiner Lieblings-Creatorinnen – z. B. auch unseren – und bleibe informiert, selbst wenn Plattformen „kippen“.
Enshittification ist mittlerweile Teil unserer (digitalen) Realität und auch wenn es frustrierend sein kann: Nutzerinnen sind nicht machtlos, du bist nicht machtlos! Durch bewusste Entscheidungen, Datenschutz und öffentlichen Druck können wir zumindest mitgestalten, wie stark uns diese Entwicklung im Alltag (be-)trifft. Und wer weiß – vielleicht führt genau dieser Druck langfristig dazu, dass neue, fairere Angebote entstehen.
Wo begegnet dir im Alltag Enshittification? Teile deine Beispiele gerne mit der Community!
1 Doctorow, Cory (2025): Enshittification: Why Everything Suddenly Got Worse and What to Do About It.
* Wegen der besseren Lesbarkeit benutzen wir nur die weibliche Form. Alle Menschen sind explizit mitgemeint.

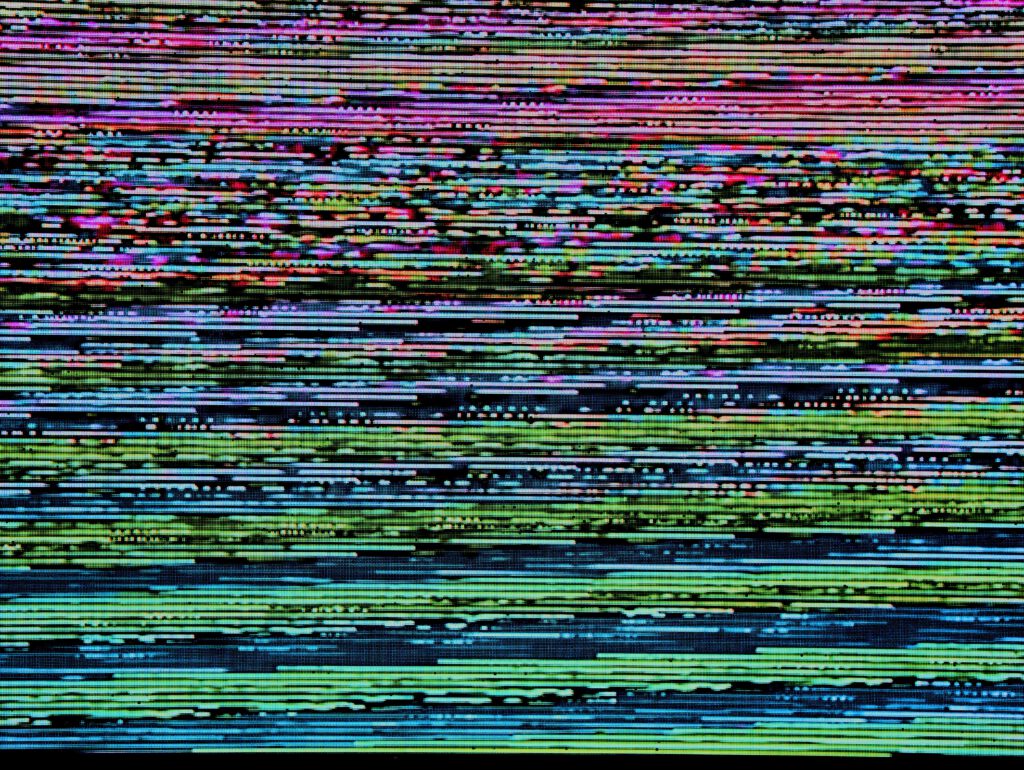
Liebe Claudia,
vielen Dank für diesen sehr informativen Artikel. Das war mir so tatsächlich nicht bewusst. Ich werde in meinem Alltag mehr auf die Enshittification achten.
Herzlich
Marianne
Liebe Marianne,
sehr gerne! Schön, dass dir der Artikel gefallen hat!
Herzliche Grüße
Claudia